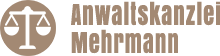Warum die Herkunft Ihrer Kontaktdaten jetzt noch wichtiger ist!
Die Gewinnung neuer Geschäftskunden ist essenziell, doch der Weg dorthin ist rechtlich oft steinig. Insbesondere die Kaltakquise per E-Mail, also die unaufgeforderte werbliche Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden, bewegt sich in einem rechtlichen Minenfeld. Während die Hürden durch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) bereits hoch sind, verschärft die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – unter dem wachsamen Auge des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) – die Anforderungen an die Herkunft und Verarbeitung der dafür genutzten Kontaktdaten erheblich.
Die Ausgangslage: Kaltakquise per E-Mail ist grundsätzlich unzulässig
§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG stellt klar: Werbung unter Verwendung elektronischer Post (E-Mail) ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten stellt eine unzumutbare Belästigung dar und ist somit wettbewerbswidrig. Die oft zitierte Ausnahme des § 7 Abs. 3 UWG greift nur bei Bestandskunden unter sehr engen Voraussetzungen und ist für die Erstansprache (Kaltakquise) irrelevant. Im B2B-Bereich mag die Schwelle zur Annahme einer „mutmaßlichen Einwilligung“ in der Theorie etwas niedriger liegen als bei Verbrauchern, doch die Rechtsprechung ist auch hier sehr streng. In der Praxis ist die Kaltakquise per E-Mail ohne vorherige, ausdrückliche Einwilligung fast immer rechtswidrig nach UWG.
Die DSGVO-Dimension: Jede E-Mail-Adresse ist ein personenbezogenes Datum
Selbst wenn man die wettbewerbsrechtlichen Hürden des UWG außer Acht ließe (was fahrlässig wäre), kommt man an der DSGVO nicht vorbei. Denn jede E-Mail-Adresse, auch eine geschäftliche wie vorname.nachname@firma.de oder geschaeftsfuehrung@firma.de, ist ein personenbezogenes Datum. Das bedeutet:
- Rechtmäßigkeit der Verarbeitung (Art. 6 DSGVO): Jede Verarbeitung dieser Daten – das beginnt schon beim Erheben und Speichern, geht über die Nutzung für den E-Mail-Versand bis hin zur Analyse von Öffnungsraten – benötigt eine gültige Rechtsgrundlage.
- Herkunft der Daten entscheidend: Woher stammen die Kontaktdaten der Geschäftsführer, Abteilungsleiter oder anderer Firmenvertreter, die Sie anschreiben möchten? Wurden sie von Visitenkarten übernommen, aus öffentlichen Registern (z.B. Impressum) kopiert, über soziale Netzwerke (wie LinkedIn/Xing) gesammelt oder gar von Adresshändlern gekauft?
Das Problem: Fehlende Rechtsgrundlage und zweifelhafte Datenquellen
Für die Kaltakquise per E-Mail wird oft versucht, sich auf das „berechtigte Interesse“ (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) als Rechtsgrundlage zu stützen. Hierfür ist jedoch eine umfassende Interessenabwägung notwendig: Das Marketinginteresse des Unternehmens muss gegen die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person (des E-Mail-Empfängers) abgewogen werden. Angesichts der strengen Vorgaben des UWG, die ja gerade den Schutz vor unzumutbarer Belästigung bezwecken, überwiegen bei unaufgeforderter E-Mail-Werbung in aller Regel die Interessen des Empfängers.
Der Einfluss des EuGH: Stärkung der Betroffenenrechte und Transparenz
Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hat die Anforderungen der DSGVO in den letzten Jahren immer wieder präzisiert und dabei tendenziell die Rechte der betroffenen Personen gestärkt. Wichtige Prinzipien, die durch EuGH-Urteile untermauert wurden und für die Kaltakquise relevant sind:
- Zweckbindung: Daten, die für einen bestimmten Zweck erhoben wurden (z.B. Kontaktaufnahme über das Impressum einer Webseite für geschäftliche Anfragen), dürfen nicht ohne Weiteres für einen anderen Zweck (wie unaufgeforderte Werbung) genutzt werden. Nur weil eine E-Mail-Adresse öffentlich zugänglich ist, bedeutet das keine Einwilligung in Werbemails.
- Transparenz: Die betroffene Person muss darüber informiert werden, woher ihre Daten stammen und zu welchem Zweck sie verarbeitet werden (Art. 14 DSGVO, wenn Daten nicht direkt bei der Person erhoben wurden). Dies ist bei zugekauften oder „gescrapten“ Adresslisten oft nicht gegeben.
- Nachweisbarkeit: Das werbende Unternehmen muss nachweisen können, dass die Daten rechtmäßig erhoben wurden und eine gültige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zum Zwecke der Kaltakquise vorliegt (z.B. eine informierte, freiwillige Einwilligung).
Der EuGH unterstreicht damit indirekt: Die Herkunft der Daten ist zentral. Stammen die Daten aus Quellen, bei denen die betroffene Person vernünftigerweise nicht mit einer werblichen Ansprache rechnen musste oder konnte, oder ist die Herkunft unklar bzw. illegal (z.B. Adresshandel ohne Einwilligung), fehlt es nicht nur oft an der Rechtsgrundlage nach Art. 6 DSGVO, sondern es drohen auch Verstöße gegen Transparenzpflichten und Zweckbindungsgrundsätze.
Konsequenzen und Fazit: Hohe Risiken bei Non-Compliance
Wer Kaltakquise per E-Mail betreibt und dabei die Vorgaben von UWG und DSGVO missachtet, riskiert empfindliche Folgen:
- Abmahnungen durch Wettbewerber oder Verbände nach UWG.
- Bußgelder durch die Datenschutzaufsichtsbehörden nach DSGVO, die sehr hoch ausfallen können.
- Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche von betroffenen Personen oder Unternehmen.
- Reputationsschaden.
Empfehlung:
Bevor Sie oder Ihr Unternehmen Kaltakquise per E-Mail in Erwägung ziehen, ist eine sorgfältige rechtliche Prüfung unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht nur die strengen Anforderungen des UWG erfüllen (was meist eine vorherige Einwilligung erfordert), sondern auch, dass die Erhebung und Verarbeitung der dafür genutzten personenbezogenen Daten (insbesondere der Kontaktdaten von Firmenvertretern) auf einer soliden Rechtsgrundlage der DSGVO basiert und die Herkunft der Daten lückenlos nachvollziehbar und legal ist.
Die Zeiten, in denen man „einfach mal“ Adressen aus dem Internet sammelte und anschrieb, sind endgültig vorbei. Die rechtlichen Fallstricke sind zahlreich und die Konsequenzen können gravierend sein.